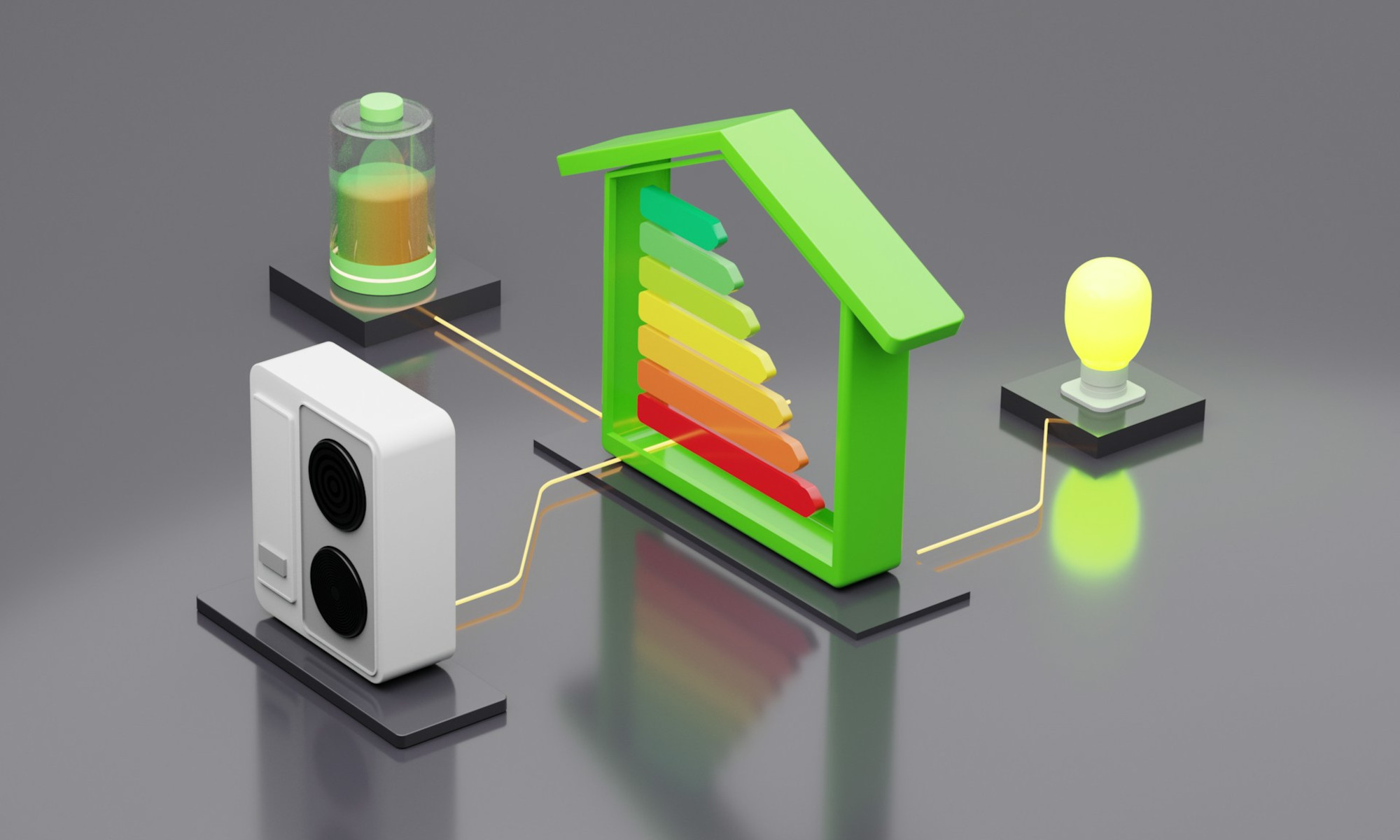Es ist ein kalter Winterabend in einer beschaulichen Wohnsiedlung am Stadtrand von München. Familie Meier sitzt gemütlich im Wohnzimmer, während draußen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Ihre Wärmepumpe läuft auf Hochtouren, um das Haus warm zu halten. Doch was passiert, wenn das Stromnetz an seine Grenzen stößt? Seit 2024 dürfen Netzbetreiber in solchen Fällen den Strom für Wärmepumpen und E-Auto-Ladestationen drosseln – eine Regelung, die bei Verbrauchern wie den Meiers gemischte Gefühle auslöst.
Die neue Regelung: Schutz vor Überlastung oder Einschränkung für Verbraucher?
„Ich finde es gut, dass die Netze geschützt werden sollen“, sagt Thomas Meier, der vor zwei Jahren auf eine Wärmepumpe umgestiegen ist. „Aber ich mache mir Sorgen, ob wir im Winter genug Wärme haben, wenn die Pumpe gedrosselt wird.“ Die neue Regelung sieht vor, dass Netzbetreiber bei drohender Überlastung den Strombezug von Wärmepumpen und Ladestationen reduzieren dürfen. Allerdings muss immer eine Mindestleistung von 4,2 Kilowatt gewährleistet sein – genug, um die Heizung am Laufen zu halten und das E-Auto für 50 Kilometer Strecke in zwei Stunden zu laden.
Doch nicht alle Nutzer sind so optimistisch wie Familie Meier. „Ich habe extra in eine moderne Wärmepumpe investiert, um unabhängiger zu sein“, klagt Sabine Bauer aus Hamburg. „Jetzt soll ich plötzlich damit rechnen, dass mir jemand den Hahn zudreht? Das fühlt sich wie ein Rückschritt an.“
Smart Meter: Die fehlende Brücke zur intelligenten Steuerung
Ein zentrales Problem ist die mangelnde Digitalisierung der Stromnetze in Deutschland. Während Länder wie Dänemark oder Schweden flächendeckend Smart Meter einsetzen, hinkt Deutschland hier weit hinterher. Von den 52 Millionen Stromzählern sind gerade einmal 270.000 intelligent – eine Quote von nur fünf Prozent.
„Ohne Smart Meter können wir die Netze nicht dynamisch steuern“, erklärt Energieexperte Felix Janssen vom Digitalverband Bitkom. „Das ist, als würde man versuchen, den Verkehr in einer Großstadt ohne Ampeln zu regeln.“ Die Folge: Netzbetreiber können zwar einzelne Anlagen ansteuern, aber das Gesamtnetz bleibt starr und unflexibel.
Zwischen Verständnis und Frust
Für viele Wärmepumpen-Besitzer ist die neue Regelung ein zweischneidiges Schwert. „Ich verstehe, dass die Netze geschützt werden müssen“, sagt Markus Schneider aus Berlin. „Aber warum wird die Digitalisierung erst jetzt angegangen? Das hätte man schon vor Jahren in Angriff nehmen müssen.“
Andere sehen in der Drosselung sogar eine Chance. „Wenn ich dafür günstigeren Strom bekomme, bin ich bereit, Kompromisse einzugehen“, meint Claudia Weber aus Köln. Tatsächlich sollen Betreiber steuerbarer Geräte künftig von reduzierten Strompreisen profitieren – ein Anreiz, der bei vielen Verbrauchern gut ankommt.
Digitalisierung als Schlüssel
Die Bundesnetzagentur sieht in der neuen Regelung einen „erheblichen Digitalisierungspush“ für die Netzbetreiber. „Um die Netze vernünftig steuern zu können, muss da einiges passieren“, sagt Sprecher Fiete Wulff. Bis dahin können Netzbetreiber präventiv eingreifen, etwa indem sie Wärmepumpen zu Stoßzeiten statisch drosseln.
Für Familie Meier ist das kein Grund zur Panik. „Wir vertrauen darauf, dass die Technik Schritt hält“, sagt Thomas Meier. „Schließlich geht es um unsere Zukunft – und die soll nachhaltig sein.“
Doch bis die Netze flächendeckend digitalisiert sind, bleibt die Frage: Wie oft wird der Strom für Wärmepumpen und E-Autos gedrosselt werden müssen? Und wie lange werden Verbraucher wie Sabine Bauer das hinnehmen?
Eines ist klar: Die Energiewende bringt nicht nur neue Technologien, sondern auch neue Herausforderungen – für Netzbetreiber, Politik und Verbraucher gleichermaßen.